Jochim Seidel - Vereinsmitglied, Heimatforscher
• 26.02.1927 † 22.09.2012 Joachim Seidel war Vereinsmitglied seit Gründung am 27.05.2001. Viele Freizeit widmete er der Geschichte von Bad Klosterlausnitz und des Holzlandes. Wir werden sein Andenken ehren. |
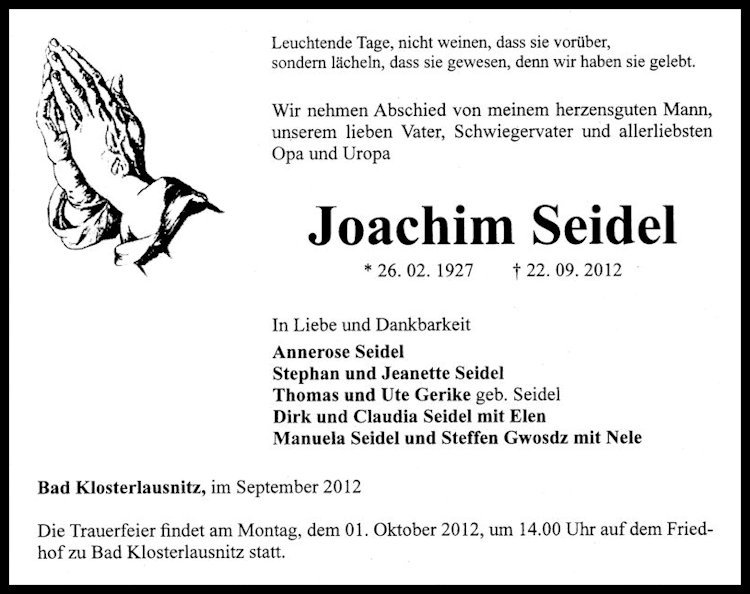
Jens Peter und Joachim Seidel

Joachim Seidel - vorn Mitte bei einer Vereinsveranstaltung.
26.02.1927 geboren
1933 - 1936 Volksschule Bad Klosterlausnitz
1937 - 1942 Mittelschule Hermsdorf
1942 - 1944 Oberschule Eisenberg
Sept. 1944 - Februar 1945 Dienstzeit Reichsarbeitsdienst
März 1945 - April 1945 Wehrmacht
Mai 1945 Flucht aus Gefangenschaft, wieder zu Hause
02.05.1945 - 15.07.1947 Landratsamt Stadtroda Verwaltungsangestellter
16.07.1947 - 31.12.1965 Gemeindeamt Bad Klosterlausnitz, Verwaltungsangestellter
01.01.1966 - 24. 09.1969 PGH Bau Weißenborn Verantwortl. Buchhalter
20.10.1969 - 10. 08.1983 VEB Keramische Werke Sachgebietsleiter / Betriebsökonomie
01.01.1991 - 29. 02.92 Altersübergangsgeld
01.03.1992 Altersrentner
Von Juni 1946 bis Dezember 1948 ist für das Klosterlausnitzer Standesamt Herr Hans Hermann zuständig. Als dessen Stellvertreter zeichnet Ernst Wallrodt.
Vom 01. Januar 1949 bis zum Juni 1957 ist Ernst Wallrodt als Standesbeamter von Bad Klosterlausnitz tätig. Den Stellvertreter in diesem Zeitraum übernimmt z.B. im Jahre 1955 wieder Herr Hans Hermann. Aber auch die stellvertretende Bürgermeisterin Minna Kraft übt dieses Amt aus. Wenn keine Vertretung möglich war, kam es zu einer sogenannten Notfallbestellung durch andere Standesämter. Dadurch wurden auch manche Beurkundungen durch Frau Weiß vom Hermsdorfer Standesamt vorgenommen.
Seit 01. Juli 1957 wird die Arbeit des Standesbeamten* von Herrn Moritz Kirchner weitergeführt. Minna Kraft ist weiterhin auch als Stellvertreterin tätig.
Ab September 1961 werden auch von Joachim Seidel Beurkundungen in Vertretung vorgenommen. Erstmals im Mai 1963 zeichnet Joachim Seidel nicht mehr als Stellvertreter.
Joachim Seidel führt die Geschäfte des Klosterlausnitzer Standesamtes noch bis Dezember 1965. Aus der Amtszeit von Herrn Seidel möchte der Autor auf der folgenden Seite eine Begebenheit aus dem Jahre 1963 wiedergeben, welche dem Standesamt im Rathaus von Bad Klosterlausnitz zu einem besonderen Bekanntheitsgrad verhalf.
Das NEIN bei einer beabsichtigten Eheschließung (siehe unten).
Als letzte Beauftragte für das Personenstandswesen ist Frau Else Körner auf dem Standesamt in Bad Klosterlausnitz zu nennen. Frau Körner begleitete dieses Amt vom Januar 1966 bis zum März 1976. Als Stellvertreterin stand ihr Frau Lucie Rolle zur Seite. Danach wurde das Standesamt im Klosterlausnitzer Rathaus aufgelöst.
Bereits in einem Schreiben vom 10. Dezember 1970, in dem es um die Überprüfung der Urkundenstellen des Kreises Stadtroda geht, wird zum Standesamt Bad Klosterlausnitz erwähnt: „Bei 42 durchgeführten Eheschließungen und 12 beurkundeten Sterbefällen bisher im Jahre 1970 befürworten auch der Bürgermeister, wie auch seine Mitarbeiter der Gemeinde Bad Klosterlausnitz einen Anschluss ihres Standesamtes an den Standesamtsbezirk der Stadt Hermsdorf.“
Bis zur Angliederung vergehen aber noch fast 5 Jahre. Am 28.Januar 1976 kommt das Thema als Beschlussvorlage in die Sitzung des damaligen Rates des Kreises. Thema der Vorlage: Zentralisierung der Standesämter. Angliederung des Standesamtes Bad Klosterlausnitz an das Standesamt Hermsdorf. Es wurde dazu folgender Beschluss gefasst:
„Der Rat des Kreises beschließt, zur weiteren Zentralisierung der Standesamtsbereiche im Kreis den Standesamtsbereich Bad Klosterlausnitz aufzulösen und dem Standesamtsbereich Hermsdorf anzugliedern. Diese Auflösung und Angliederung erfolgt mit Wirkung. ... Die Gemeindevertretung von Bad Klosterlausnitz stimmte der Auflösung des Standesamtes Bad Klosterlausnitz und der Angliederung an das Standesamt Hermsdorf zu, nachdem die Einwohner in den durchgeführten Versammlungen befragt wurden.“
Die endgültige Auflösung erfolgte am 01. März 1976. Der damalige Bürgermeister Paul Buchda hält fest: „Zur weiteren Entwicklung des Gemeindeverbandes `Holzland´ wird gemäß Beschluss des Rates des Kreises Stadtroda mit Wirkung vom 01. März 1976 der Standesamtsbereich Bad Klosterlausnitz aufgelöst und dem Standesamtsbereich Hermsdorf angegliedert.
* In der DDR lautete die offizielle Bezeichnung für einen Standesbeamten – Beauftragter für das Personenstandswesen.
So geschehen am 15. Juni 1963 auf dem Standesamt in Bad Klosterlausnitz. Der Schreiber dieses Aufsatzes war damals der Standesbeamte.
Anfang Juni erschienen E.P. und R.T. auf dem Standesamt, um einen Termin für ihre Eheschließung zu beantragen. Sie legten die erforderlichen Papiere vor, und der Termin wurde auf den 15. Juni 1963, 10.00 Uhr festgelegt.
E. P. war mir persönlich bekannt. Trotzdem erkundigte ich mich beim Gesundheitsamt des Rates des Kreises vorsichtshalber, ob etwas bei dem Vorgenannten gegen eine Ehefähigkeit einzuwenden wäre. Die Antwort war: „Unbedenklich, keinerlei Einwände“ Daraufhin nahm ich die üblichen Vorarbeiten vor: Eintragung der Personalien im Eheschließungsbuch, das damals ein gebundenes Buch mit nummerierten Seiten war.
Vorrausschicken möchte ich, dass wir damals keine gesonderten Standesamtsräume hatten, und die Eheschließungen in meinem Arbeitszimmer stattfanden. Hierzu wurde dieses mit grünblättrigen Blumenstöcken aus anderen Zimmern und Blumensträußen geschmückt. So auch am 15. Juni 1963.
Plötzlich klopfte es gegen 9.30 Uhr, eine halbe Stunde vor dem festgelegten Termin, und herein kam das Brautpaar. Der vermeintliche Bräutigam E.P. fragte, ob die Trauung nicht jetzt schon erfolgen könnte. Ich verneinte mit der Begründung, wir seien noch in den Vorbereitungen. Daraufhin verließen sie den Raum und nahmen im Vorzimmer Platz.
Gegen 9.45 Uhr bat ich sie herein, hielt nach der Begrüßung die Ansprache und stellte danach die vorgeschriebene Frage: „E.P. sind Sie bereit, mit R.T. die Ehe einzugehen, so antworten Sie mit Ja.“ – „Ja.“ War die Antwort, und ich fragte weiter: „Und Sie R.T., sind Sie bereit mit E.P. die Ehe einzugehen, so antworten Sie mit Ja.“ – Totenstille, keine Antwort.
In der Annahme, sie habe in der Aufregung meine Worte nicht gehört, wiederholte ich die Frage, worauf ein deutlich hörbares „NEIN!“ erfolgte.
Ich war überrascht und wusste im ersten Augenblick nicht, wie ich mich verhalten sollte. E.P. stürmte unter Tränen auf seine Braut ein und stammelte: „Sag doch ja, sag doch ja.“ Aber die Braut sagte keinen Ton und bewegte sich zur Tür zu, E.P. hinterher.
Auch für mich war es ein Schock und auch in Schulungen für Standesbeamte hatte ich noch nie gehört, dass jemand irgendwann Nein gesagt hatte.
Noch war die Amtshandlung nicht abgeschlossen, denn es bedurfte eines Randvermerkes im Ehebuch. Dieser hatte einen bestimmten Wortlaut. Meine Anfrage danach beim Rat des Kreises, Standesamtswesen, Herrn Jakob, war negativ. Ein solcher Fall sei ihm bisher unbekannt, er müsse beim Rat des Bezirkes Gera nachfragen. Dort dieselbe Sprachlosigkeit, so dass Berlin befragt werden musste.
Von dort kam auf demselben Wege: Rat des Bezirkes – Rat des Kreises – nach einer Woche der amtliche Wortlaut bei mir an.
Er lautete: „Die Verlobte R.T. verneinte die Frage. Die Ehe wurde nicht geschlossen.“
Diesen Wortlaut trug ich als Randvermerk ein, siegelte ihn ab, und erst jetzt war dieser Fall standesamtlich abgeschlossen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die „Neinsage“ im Ort und oft wurde ich dazu angehalten.
Fast nach genau 44 Jahren wurde ich an dieses Geschehen erinnert, sollte ich doch anlässlich des hundertjährigen Gründungstages des Rathauses zu Bad Klosterlausnitz dieses Geschehen in Form einer Abhandlung, zwecks Aufnahme in eine Festschrift, niederschreiben.
Das Standesamt im Rathaus von Bad Klosterlausnitz war durch diese „Neinsage“ plötzlich weit und breit bekannt geworden.
Joachim Seidel – ehemals Standesbeamter.
DIE WEGE ZU MEINER HEIMATFORSCHUNG
Angeregt von den Aufzeichnungen „Rückblicke auf 75 Jahre meines Lebens“ habe ich mich heute – Dezember 2003 – entschlossen, noch einmal zur Feder – sprich Kuli –zu greifen und über meine derzeitige Haupttätigkeit im Rentenalter zu schreiben. Bezog sich meine vorgenannte Niederschrift bisher überwiegend auf die Familie Seidel und Nachbarschaft in der Neuen Straße, schweiften jetzt meine Gedanken nach dem weiten Gebiete der Beschreibung von Teilen unseres Ortes, zum Teil über die Ortsgrenze hinaus.
Es soll keinesfalls eine Chronik werden, vielmehr, wie Rosinen in einem Kuchen, Recherchen von Begebenheiten, Beschreibungen aus früheren Zeiten, Wiederentdeckungen von längst Vergangenem und Vergessenem, eine Sammlung alter Abbildungen und Fotografien von Menschen, die ehemals hier lebten und wirkten und auch solche, die auf Grund ihrer Tätigkeit oder auch Sonderheiten als „typische Lausenzer“ bezeichnet wurden, weiter von alten Berufen und Tätigkeiten, Gebräuchen unserer Vorfahren, Beschreibung von Teilen der Natur: wie Bäche, Teiche, Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Wege und Straßen, markanter Bäume und vieles mehr. Alles in allem: H e i m a t f o r s c h u n g, angefangen vom Kloster zu Lausnitz, dem alten Ort Lausnitz, später Klosterlausnitz und ab 1932 Bad Klosterlausnitz. Ein Gebiet, das unerschöpflich ist, aber sich lohnt, Stück für Stück angegangen zu werden, bereits Vergessenes aufzuspüren, niederzuschreiben, damit es der Nachwelt erhalten bleibt.
Ich war mir bewusst, was da auf mich zukam, denn es gab Ende der 90-iger Jahre des 20. Jahrhunderts, nachdem der Ortschronist Heinz Vogel verstorben war, keinem im Ort, der zur Erforschung der Heimatgeschichte ernsthaft und beharrlich beitragen wollte. Immer wieder bekam ich die Antwort: keine Zeit, mir fehlt das Wissen und die Geduld und alte Leute, die noch etwas von früher wissen könnten, die kenne ich nicht.
Einflechten möchte ich, dass Heinz Vogel aufopferungsvoll und sehr viel für die Ortschronik getan und gesammelt hat. An manchen Stücken war ich selbst daran beteiligt. Nachdem sich mit dem Leiter des Thüringischen Staatsarchivs Altenburg immer engere und freundschaftliche Beziehungen anbahnten, erhielt er von diesem Archiv großzügige Unterstützung und Zugang und konnte natürlich manch wertvolle Kopie von Urkunden und Kartenmaterial für die Ortschronik erwerben, was heute so nicht mehr möglich ist.
Heinz Vogel legte den Grundstock für die Ortschronik. Leider verfasste er kaum eine Niederschrift. Dafür ging er von Haus zu Haus, erwarb überwiegend leihweise viele Postkarten und Fotografien. Leider vermerkte er nur in wenigen Fällen auf der Rückseite derselben die Namen, so dass heute viel Bildmaterial aus vergangenen Jahrzehnten vorhanden ist, aber die Personen unbekannt sind.
Das Material der Ortschronik, das Heinz Vogel in seinem Hause für die Gemeinde verwaltete, wurde nach seinem Tode – angeblich komplett – der Gemeinde übergeben, die leider diese Unterlagen stiefmütterlich im feuchten Keller des Rathauses aufbewahrte und die Nässe verschiedene in Pappkartons verwahrte Unterlagen beschädigte.
Seitdem das Heimatmuseum im alten Sudhause der ehemaligen Kommun- Brauerei 2002 fertig gestellt war, wurden sämtliche Akten der Ortschronik nach dort umgelagert und seitdem von Jens Peter, einem jüngeren, aber äußerst aktiven Heimatfreund, aufgearbeitet und verwaltet.
Doch ich muss wieder zurück in die Zeit, wo ich den Anfang machte, mich mit der Ortsgeschichte ernsthaft zu befassen. Ich zeigte schon in jüngeren Jahren an Zeitungsartikeln, Kalenderblättern und Büchern, die etwas über meinen Heimatort aussagten, Interesse und sammelte diese. Das waren aber nur Tropfen auf den heißen Stein. Ich wollte anders, tiefgründiger und systematisch an mein Vorhaben herangehen. Chroniken, Kirchenbücher und Festschriften waren die Grundlagen für mein Unternehmen. Es mussten doch wenigstens über das Kloster, die Mutter für das spätere Dorf Lausnitz, Chroniken geschrieben sein. Nachfragen im Pfarramt waren infolge wiederholter Wechsel der Pfarrer anfangs nicht erfolgreich. Doch dann stieß ich auf die von Gewerbeoberlehrer Gräfe verfasste Festschrift „8oo Jahre Bad Klosterlausnitz“ zur Feier vom 17. bis 22. August 1938. Er behandelte darin u. a. die Klostergeschichte, die alte Dorfgeschichte bis zur Zeit der 30-iger Jahre des 20. Jahrhunderts. In der Klostergeschichte nannte er mehrere Pfarrer und Gelehrte, die über das Kloster geschrieben hatten.
Das war für mich der Anstoß zu recherchieren, wie viele Chroniken oder Schriften es noch über das Kloster und später über den Ort gab. Anlaufstätten waren wiederum die Pfarrei Bad Klosterlausnitz, Stadtarchiv Eisenberg, Universitätsbibliothek Jena, Thüringisches Staatsarchiv Altenburg. Das Stadtarchiv Eisenberg war sehr hilfsbereit. Im Verlaufe mehrer Jahre intensivster Nachforschung war ich im Besitz von nachstehenden Chroniken und Schriften, z. T. auf Disketten, Kopien und Originalen, welche die Grundlage meiner Forschungstätigkeit bildeten:
B A C K, A. L. :
“Chronik der Stadt und des Amtes Eisenberg von den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1843“, Band 1 und Band 2
G S C H W E N D, M. J. D. :
“Eisenbergische-Stadt-und-Land-Chronika (Nr. 546-553 entsprechen Seiten 285–259?)
M O S E R, August, Pastor zu Serba:
„Marienstein“ oder „Die Gründung des Klosters zu Laußnitz“
H A S E, Dr. Ed.:
“Die Gründung und das erste Jahrhundert des Klosters Lausnitz“
L Ö B E, D. J. und L Ö B E, E.:
„Geschichte der Kirchen und Schulen des Herzogthums Sachsen-Altenburg mit besonderer Berücksichtigung der Ortsgeschichte“: 3. Band, Altenburg 1891, S. 98 - 112
M E I S S N E R, Friedrich - Forstrat - : Chronik über Klosterlausnitz
D I E T Z E , Paul - Pfarrer zu Petersberg - : „Geschichte des Klosters Lausnitz
G R Ä F E , Richard – Gewerbelehrer -Bad Klosterlausnitz:
Festschrift und Chronik „800 Jahre Bad Klosterlausnitz“, 1938
S T A R K E, Richard:
„Zum Gedächtnis und Zeugnis. Geschichte der Gründung des Klosters Lausnitz“ und
„Festschrift zum 700-jährigen Kirchweihjubiläums“ , Altenburg 1880
W E R N E R Gustav: „Geschichte des Klosters zu Lausnitz“, Klosterlausnitz 1926
K N O B E N, Ursula - Gauting 1969 -:
“Die Kirche des ehemaligen Augustiner-Nonnenklosters in Klosterlausnitz“ und
„Die romanischen Teile und der Restaurationsbau des 19. Jahrhunderts“
EVANGELISCH – LUTHERISCHES PFARRAMT Bad Klosterlausnitz
und Alexandra C L A U S S:
Bad Klosterlausnitz : “Geschichte des Klosters Lausnitz“ (14-seitiges Kirchenblättchen)
V O GE L, Heinz: „Chronik 850 Jahre Bad Klosterlausnitz 1137 – 1986“
Die Chroniken Back, Meißner und Gräfe sind unentbehrlich für die außerklösterliche Forschung. Hinzu kommt Schöppe: „Erinnerungen eines alten Klosterlausnitzers“.
Eine weitere Fundgrube waren die 48 Mitteilungshefte des Altertumsforschenden Vereins Eisenberg von 1886 bis 1939. Monatelang benötigte ich dazu, diese Hefte von ca. zehn verschiedenen amtlichen Stellen und Privatpersonen ausgeliehen zu bekommen und sie zu Hause zu kopieren. Unzählige Stunden und Pakete von Papier nahmen die Kopierarbeiten in Anspruch. Die Hefte aber komplett sein Eigentum nennen zu können, wog alle Schwierigkeiten und Zeitaufwand wieder auf. Viele darin behandelten Themen konnte ich für meine Forschung verwenden.
Ähnlich erging es der Schriftenserie „Zwischen Saale und Elster“ und den „Heimatblätter für den Landkreis Stadtroda“, die ebenfalls nur durch Ausleihe und zum Teil Erwerb einzelner Originale durch Kopien komplettiert werden konnten. Interessante Artikel und Beschreibungen daraus treffen auch auf unser Gebiet zu und lassen das Forscherherz immer wieder höher schlagen. Aufzeichnungen und Artikel in alten Hauskalendern ergänzten obige Aufzählungen.
Es gehörte aber auch Kartenmaterial für meine Forschung dazu wie:
Flurkarten, Forstkarten, alte Wanderkarten, Messtischblatt 1 : 25.000. Besonders wertvolle Dienste leistete mir die bei Gräfe im Anhang seiner Festschrift beigefügten Forstkarte mit den alten Flur- und Forstnamen.
Als weitere Autoren sind zu nennen:
F E US T E L, Dr.: „Das Thüringer Holzland“
K R E B E S, Kathrin:
“Das Holzland – eine Landschaft in Thüringen und seine Geschichte“, 1993
LANDRATSAMT EISENBERG – Naturschutzbehörde:
NSG „An den Ziegenböcken“, „Rote Pfütze“, „Stilles Tal;
WARSITZKA, W. und LEITNER, H.:
“Beiträge zur Wirtschaft und Sozialgeschichte Ostthüringens“;
GENTZSCH:
Belegarbeit: „Die Klosterlausnitzer Sümpfe“
DIVERSE GUTACHTEN :
über das Klosterlausnitzer Moor (Lageskizzen, Mächtigkeit- von Hermann SACHSE bis zum Moorbad 1938 (Zeitungsberichte über die Weihe desselben)
DIVERSE BELEGARBEITEN von Schülern
Das waren wichtige Unterlagen für meine von mir gefertigten Niederschriften, die ich intensiv seit Ende der 90-iger Jahre des 20. Jahrhunderts und seit 2000 betrieb.
Überlegungen, Teilgebiete von und aus unserem Ort zu beschreiben, schwebten mir schon viel früher vor. Es waren aber immer nur Vorstellungen. Dann aber gab ich mir einen Ruck, nachdem auch Dr. Uwe Träger, Weißenborn, studierter Geschichts- und Heimatschreiber, mehrere Hefte über Heimatgeschichte veröffentlicht hatte und suchte nach Themen, die von mir in ein bis 6 A-4-Seiten, manche auch mehr, abgehandelt wurden. Dabei ging ich wahllos vor, so, wie mir gerade etwas einfiel. Im Verlaufe meiner Niederschriften konzentrierte ich mich mehr auf zusammenhängende Themen, beispielsweise unsere Bäche, Teiche, Kies- und Sandgruben in Klosterlausnitz, Weißenborn und Tautenhain, von denen ich aus früheren Veröffentlichungen nichts oder recht wenig entnehmen konnte.
Beginnen wir aber der Reihe nach:
Meine erste Aufzeichnung entstand Ende 1945, nachdem ich zweimal aus der Gefangenschaft glücklich entkommen war und nach zweimonatiger Tätigkeit bei der amerikanischen Militärverwaltung als „kleiner Dolmetscher“, danach vom Landratsamt Stadtroda übernommen wurde. Meine dortige Tätigkeit erlaubte es zeitmäßig, schriftlich einen längeren Rückblick zu halten über die Zeit, wo ich beim RAD (Reichsarbeitsdienst) und bei der Wehrmacht Dienst tun musste. Selbst war man damals noch in der Sturm- und Drangzeit, wo
„Meine letzten Tage vor dem Zusammenbruch“ entstanden, die in der Aufzeichnung „Rückblicke auf 75 Jahre meines Lebens“ ihren Platz gefunden haben.
Dann kam eine sehr lange Periode gar nichts, bis ich beim Aufräumen und Sichten von Fotos auf ein kleines blaues Oktavheftchen (Vokabelheft) stieß, in dem ich von mir mit Bleistift geschriebene Notizen und kurze Sätze fand über: „Stein Fritzens Abdeckerei auf dem Buchberge“. Sofort erinnerte ich mich daran, wer mit mir – Mitte der 50-iger Jahre – davon erzählt hatte (der Bauer Paul Schütze = „dr Schmeelenschträcher“, Weißenborner Straße) während der Pflichtablieferung von Eiern auf dem Gemeindeamte.
Und weil solch alte Geschehnisse mich bereits damals interessierten gab es nun natürlich nichts Anderes als auf der Grundlage dieser Notizen in dem blauen Heftchen einen ausführlichen Bericht zu schreiben, nämlich „Stein Fritzens Abdeckerei auf dem Buchberge“.
Im gleichen Monat August 2000 entstand der Bericht über die FLUWA (Flugwache), einer Baracke mit Turm, die unmittelbar neben Stein Fritzens ehemaliger Abdeckerei zwischen 1939 – 1945 aufgebaut und genutzt wurde.
Beim Abbruch des Sockels und des Fundamentes des ehemaligen Kaiser-Friedrich III-Denkmales am Klosterteiche am 28, April 1969 kam eine Metallkapsel zum Vorschein, angefüllt mit Zeitungen, ausführlichen Berichten und Münzen, die beim Ortschronisten der Gemeinde Heinz Vogel hinterlegt wurden. Ich machte dort handschriftliche Kopien und Abdrücke der Münzen und Medaillen (Avers und Revers) und verfasste einen Bericht darüber im Jahre 1985.
Im Jahre 1999 interviewte ich den „letzten Dachspänemacher Willy Voigtsberger“ in Bad Klosterlausnitz, fotografierte die dazu benötigten Werkzeuge und das dazu geeignete Holzmaterial und erstellte darüber einen ausführlichen Bericht. Wenige Jahre später schloss auch dieser letzte Veteran in hohem Alter für immer die Augen. Mit ihm starb auch dieser Beruf aus.
Im gleichen Jahre besuchte ich in Tautenhain einen der ältesten Besenbinder, Friedrich Stierand, der mir jeden Handgriff vom Binden eines Besens, dem Birkenreisig und der Weiden (Wieden) erklärte und zeigte. Ein interessanter, verständlicher mit vielen Fotos bestückter 12-seitiger Bericht kam dabei heraus.
Von September bis Dezember 2000 beschrieb ich Rückerinnerungen aus der Kriegszeit bis zur Besatzungszeit der Amerikaner betreffend unser Gebiet. In dieser Zeit, November, Dezember 2000, erinnerte ich mich an die Zeiten im Kriege und an die Nachkriegszeiten und schrieb:
„Wir kochen Pflaumenmus“,
„Wir kochen Zuckerrübensirup“
und „Hausschlachtung bei Seidels“, drei Themen, an denen ich persönlich beteiligt war und alle Zusammenhänge und Vorgänge sehr gut kannte.
Im Dezember 2000 begann ich mit viel Recherchieren und Befragen noch vorhandener Zeitzeugen den Bericht „Der Absprung eines amerikanischen Bomberpiloten zwischen Tautenhain und Weißenborn“ am 24. August 1944, der zwar abgeschlossen scheint, aber an dem ich noch daran bin, das i-Pünktchen ausfindig zu machen, um dann endgültig diesen Bericht zu beenden. Er hat mich dermaßen in den Bann gezogen, beschäftigt mich heute noch und ist von allen bisherigen Berichten der Tragischste.
Bis Dezember 2000 konnte ich bereits auf 22 von mir verfasste Berichte zurückblicken.
Mein Interesse und die Leidenschaft für die Entdeckung neuer Objekte wuchs ständig, und so entstanden im Jahre 2001 weitere 25 Berichte, in denen hauptsächlichst die Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, die Bäche, markante Steine, Rode- und Siedlungsland, Sportplätze, die Rodelbahn und das Harzen im Holzlande ausführlich beschrieben wurden. Auch hier stecken unzählige Stunden der Vorbereitung, Befragungen, Bücher wälzen, Begehungen an Ort und Stelle und Fotografieren drin.
Das Jahr 2002 war ein äußerst arbeitsreiches Jahr, schrieb ich doch insgesamt 39 Berichte, kreuz und quer durch die Themen. Es waren zahlenmäßig die meisten Niederschriften. Der Arbeitsaufwand, das Recherchieren, die Befragungen, das Lesen in alten Zeitungen und Heften, das Studieren der Flurkarten und Messtischblätter, Wälzen von Lexikas, Übersetzung alter Berichte aus der altdeutschen Schrift und die genaue Rückerinnerung in meine frühe Jugendzeit für die Aufzeichnungen:
Kartoffelfeuer brennen
Der Nigrin - Stelzenman
Der Lumpenmann
Der Fellhändler
Der Scherenschleifer
Die Leichenfrau
Der Kirchendiener und
Der
Totengräber
waren so umfangreich und zeitraubend, dass es ein Außenstehender nicht einschätzen kann. Wenn nicht Beharrlichkeit, Überzeugung, Lust und Freude und Ideen bei all meinen Nachforschungen beisammen wären (fast schon eine Krankheit), hätte es nicht zu diesen Berichten kommen können. Beim Jahresrückblick auf aber auf die gelungene Arbeit freut man sich selbst und ist auch ein wenig Stolz auf das Geschaffene.
Nachdem die Gebäude der ehemaligen Kommunbrauerei von der Gemeinde übernommen und von dieser zum großen Teile abgerissen und 2002 wieder aufgebaut wurden für eine Feuerwehrstation und für ein Heimatmuseum im ehemaligen Sudhause, in welchem auch die Unterlagen der Ortschronik ihren neuen Platz gefunden haben, konnte ich mir dort neue Ideen für weitere Heimatforschung holen.
Im gleichen Jahre kam es auch zur Gründung eines Heimatvereines mit den drei Standbeinen: Heimatmuseum - Ortschronik, Heimatforschung - Kultur.
Dabei lernte ich Jens Peter, einen jüngeren Menschen, als Verwalter der Ortschronik eingesetzt, kennen und stellte fest, dass er sehr interessiert an diesem Gebiet und der Ortsgeschichte ist. Gleichzeitig als perfekter Computerfachmann und guter Organisator hätte man keinen Geeigneteren finden können. Nach geraumer Zeit stellte ich viele Gemeinsamkeit bei uns zweien fest. Er als Neuling wollte gern von mir Erfahrungen sammeln und so bilden wir beide den „harten Kern“ in der Ortsforschung, von Uwe Büchner abgesehen, der zwar große Interesse zeigt, aber wegen Mangel an Zeit kaum in Erscheinung tritt.
Jens und ich nahmen und nehmen noch regelmäßig an Lehrgängen der Volkshochschule auf dem Gebiete der Heimatforschung, Ortschronik, Archivwesen etc. teil und bilden uns hier für unsere Arbeiten weiter. Auch sind wir wöchentlich einmal im Stadtarchiv Eisenberg zu Hause und suchen in alten Zeitungen des Eisenberger Nahrichtsblattes nach Veröffentlichungen und Artikeln über frühere Ereignisse im Holzlande. Dabei stießen wir auf viele Veröffentlichungen von Gräfe, Meißner, Schneider und vor allem auf Gedichte und Geschichten von Curt Lüdke, die ich zu Hause diesen Autoren, deren bereits erfassten Berichte getrennt in Ordnern zu finden sind, zuordne.
Meine in diesem Jahre (2003) von mir behandelten Berichte waren an Anzahl gegenüber 2002 zwar weniger aber in der Erstellung derselben zeitaufwendiger und vom Wissen her anspruchsvoller. Im Jahre 2003 konnte ich zahlreiche Kopien von alten Karten und einen Plan des Geländes vom früheren Kloster um die Zeit des 19. Jahrhunderts mit dazugehörigen Flurbuchauszügen dazu erwerben. Weiterhin bedurfte sehr vieler Recherchen, Lesen alter Konspekte und Schriften (Meißner, Schneider, Befragungen Pfarrei, Förster, Einwohner, Exkursion zu den Sumpfwiesen – Wollgras – und vieles mehr).
Doch auch 2003 sind wieder wichtige und interessante Themen angesprochen, von denen etliche schon längst vergessen waren.